Wasserstoff gilt als neuer Superstar am Energiehimmel: Ein Alleskönner ohne CO2-Ausstoß – zumindest in der Theorie. Denn wie so viele Industrieprodukte kommt er nicht ohne Nebenwirkungen daher. Über die Chancen und Risiken eines Hoffnungsträgers.
Wie ein riesiger Monolith zieht sich die Stadt der Zukunft durch die Wüste. 170 Kilometer lang, 200 Meter breit, 500 Meter hoch. In ihrer endlosen Fassade spiegelt sich der Sand, im Inneren gedeiht sattes Grün. Autos gibt es nicht, die Stadtteile sind über eine schnurgerade U-Bahn-Linie miteinander verbunden – betrieben mit erneuerbarer Energie, wie alles in diesem Megaprojekt. An Saudi-Arabiens Rotmeerküste soll „The Line“ entstehen. Noch gibt es die Stadt nur in futuristischen Werbevideos, doch erste Fundamente stehen schon. Sie ist Teil des gigantischen Regionalprojekts Neom, mit dem Saudi-Arabien seinen Nordosten mit neuer, grüner Infrastruktur bebauen möchte. 450 Milliarden Euro soll Neom kosten, bis 2045 neun Millionen Menschen ein klimaneutrales Leben ermöglichen – und die Welt mit sauberer Energie versorgen. Denn ab 2026 soll dort in einem der weltgrößten Projekte „grüner Wasserstoff“ hergestellt werden – aus Sonnen- und Windkraftwerken mit einer Leistung von 2,2 Gigawatt.

HEIZUNGEN: Die Rechnung ist eindeutig: Fünf Windräder sind nötig, um tausend Haushalte mit Wasserstoff zu beheizen. Bei Wärmepumpen ist es nur eins. Wasserstoff ist zu kostbar, um ihn zu verheizen – nicht nur für die Energiewende, sondern auch für den eigenen Geldbeutel.
Das Vorhaben ist nur ein Beispiel für die schöne neue Wasserstoffwelt. In zahlreichen Ländern werden derzeit riesige Energieparks geplant, um den Hunger nach grüner Energie zu stillen. Seit Jahrzehnten wird das Gas als Schlüssel zum Klimaschutz gehandelt, doch erst in jüngster Zeit, vor allem seit Beginn des Ukraine-Krieges, ist Bewegung in die Sache gekommen.
Dass so viele Hoffnungen auf ihm ruhen, hat mit der Physik des Wasserstoffs zu tun. Er ist das kleinste und häufigste Element im Universum. Auf der Erde kommt er fast nur in gebundener Form vor, meist als Bestandteil von Wasser – er ist das H in H2O. Zum Superstar am Energiehimmel wird er in seiner molekularen, also reinen und brennbaren Form. H2 lässt sich als Energieträger speichern und transportieren. Auch Kraftstoffe kann man daraus herstellen – und dreckigen Koks in der Stahlindustrie ersetzen. Weil er aber von Natur aus kaum vorkommt, muss er aufwendig hergestellt werden.
Was viele nicht wissen: Schon heute ist Wasserstoff ein wichtiger Industrierohstoff. Methanol wird daraus erzeugt, das etwa zu Medikamenten weiterverarbeitet wird, sowie riesige Mengen Ammoniak, Grundstoff der Düngemittelindustrie. Doch die Wasserstoffwelt von heute ist nicht grün, sondern meist grau. Eine spezielle Farbenlehre beschreibt die Herkunft der Moleküle: Als „grau“ gilt Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wurde, als „schwarz“, wenn Kohle die Basis ist. Von „grünem“ Wasserstoff ist dagegen die Rede, wenn er mithilfe erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne gewonnen wurde. Ihr Strom wird genutzt, um Wasser in „Elektrolyseuren“ in ihre Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. CO2 entsteht dabei nicht, ebenso wenig wie bei der späteren Verbrennung.

PRIVATAUTOS: Da jeder Umwandlungsschritt Energie kostet, kommen Batterieautos mit derselben Strommenge dreimal weiter als Autos mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Noch schlechter schneiden Verbrenner mit H2-basierten E-Fuels ab – sie haben vielleicht in Oldtimern eine Zukunft.
Um den sauberen Allrounder ist deshalb ein regelrechter Hype entstanden. Schon länger gilt Wasserstoff als unverzichtbar für die Dekarbonisierung der Schwerindustrie, doch mittlerweile propagieren ihn zahlreiche Branchen als Allheilmittel gegen den Klimawandel. Attraktiv erscheint vielen, auch künftig etwas verbrennen zu können – ob in Autos, Flugzeugen oder Gasthermen. Auch politisch ist H2 angesagt. Kaum ein Land, das noch keine „Wasserstoffstrategie“ entwickelt hat und den Stoff mit Milliardensummen subventioniert. „Wasserstofftechnologien bestimmen das Gelingen der Energiewende“, erklärt Kanzler Olaf Scholz, „und damit die gesamte Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität.“ Die ehemalige Bildungsministerin Anja Karliczek nannte Wasserstoff gar das „Erdöl von morgen“.
Durch den Hype entsteht der Eindruck, dass Wasserstoff bald überall zum Einsatz kommen könnte. Doch ist er wirklich die Klimalösung? Die Sache hat gleich drei Haken.
1. Profitiert vor allem die Erdgaslobby?
Vier Millionen Tonnen Wasserstoff will Saudi-Arabien bis 2035 produzieren. Wie viel davon „grün“ sein wird, dazu macht der Golfstaat keine Angaben. Im Osten des Landes liegt das riesige Schiefergasfeld Dschafurah. 110 Milliarden Euro sollen in die Erschließung der Vorkommen und in den Aufbau von Anlagen fließen, die daraus – Achtung, eine weitere Farbe – „blauen“ Wasserstoff erzeugen sollen. Bei dieser Variante wird das CO2 bei der Produktion mittels Carbon Capture and Storage (CCS) bei der Förderung abgeschieden und in den Boden verpresst. So die Theorie.
„Bevor wir Wasserstoff als Lösung für den Klimawandel darstellen“, sagt der britische Energieanalyst Michael Liebreich, „müssen wir uns zunächst mit Wasserstoff als Problem befassen.“ 96 Prozent des derzeit produzierten Wasserstoffs sind grau, hinzu kommt ein kleiner schwarzer Anteil. Noch ist der Rohstoff ein Klimakiller: Über 800 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich für seine Herstellung in die Atmosphäre geblasen – mehr als ein Land wie Deutschland insgesamt pro Jahr emittiert.
Besonders gut kennt sich also die Gaslobby mit Wasserstoff aus. Und laut einem Report von „Lobby Control“ nutzt sie den Hoffnungsträger vor allem, um Druck von ihrem fossilen Geschäftsmodell zu nehmen. „Keine Frage, der Stoff ist ein Baustein für den Klimaschutz“, sagt Nina Katzemich von der lobbykritischen Initiative. „Doch je größer der Durst nach ihm wird, umso mehr profitiert vor allem die Gasindustrie.“ Denn deren Lösung für das CO2-Problem ist vor allem blauer Wasserstoff.

STAHL- UND CHEMIEINDUSTRIE: Schon jetzt verbrauchen diese Branchen enorme Mengen Wasserstoff, jedoch klimaschädlichen „grauen“ aus Erdgas. Die Technologie ist also da, fehlt nur noch der grüne Rohstoff. Die Industrien fordern, bei dessen Verteilung an erster Stelle zu stehen. Elektrische Alternativen gibt es nicht.
Seit ein paar Jahren schon fordern Gasunternehmen wie Winter shall Dea und Uniper, dass eine Wasserstoffstrategie – und entsprechende Subventionen – alle Varianten des Gases miteinbezieht. Die Lobbyorganisation „Zukunft Gas“ beschreibt blauen Wasserstoff als „nahezu klimaneutral“, für den „H2-Markthochlauf“ sei er als „Brückentechnologie“ unabdingbar.
Klimaschutzgruppen warnen dagegen, blauer Wasserstoff sei viel klimaschädlicher als behauptet. Laut einer Studie der Cornell Universität in den USA fangen CCS-Anlagen längst nicht alle Emissionen ein, die bei der Herstellung entstehen. Auch wenn neuere Verfahren besser seien, lösten sie nicht das Problem, dass schon bei der Gasförderung durch Lecks Methan entweicht, das den Treibhaugaseffekt kurzfristig weit stärker befeuert als CO2.
„Wir befürchten, dass unter dem grünen Deckmantel Wasserstoff die fossilen Projekte weitergefördert werden – und die Gasindustrie ihr Geschäftsmodell auf Jahre verlängern könnte“, sagt Christiane Averbeck von der Klima-Allianz Deutschland. Im Juni veröffentlichte die Bundesregierung ihre überarbeitete Nationale Wasserstoffstrategie. Darin steht nun, dass auch blauer Wasserstoff für eine Übergangszeit gefördert und importiert werden soll. Für Averbeck ein klarer Erfolg der Gaslobby.
Die Wissenschaft ist sich über die Rolle von CCS-Wasserstoff uneinig. So sieht das Öko-Institut in der blauen Variante eine mögliche Lösung für die nächsten zwanzig Jahre, um CO2 einzusparen, während sich der Markt für grünen Wasserstoff entwickelt. „Da aber bei der Produktion von blauem Wasserstoff weiter Treibhausgase entweichen, kann er langfristig nicht Teil einer klimaneutralen Zukunft sein“, sagt Roman Mendelevitch vom Öko-Institut.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hingegen spricht sich klar gegen jeglichen Einsatz von blauem Wasserstoff aus. Damit würde in Technologien und Infrastrukturen investiert, die in Zukunft keinen Platz mehr hätten, sagt die Ratsvorsitzende Claudia Kemfert. Sie warnt vor neuen Abhängigkeiten.
Klar ist, dass auch für das blaue Gas viel Geld in Anlagen investiert werden muss, die sich oft erst nach Jahrzehnten rentieren. Die Erschließung des Dschafurah-Gasfeldes macht Saudi-Arabien zu einem führenden Gasproduzenten. Auch in Norwegen, wo Robert Habeck im Januar bei einem Besuch vom CCS-Gegner zu dessen Anhänger wurde, ist kein Erdgasausstieg geplant. Im Gegenteil: Aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus Europa will das Land die Förderung ausdehnen – in arktischen Gewässern. Die Brüsseler NGO Corporate Europe Observatory sieht Wasserstoff daher als „trojanisches Pferd der fossilen Industrie“.
2. Droht ein grüner Kolonialismus?
Auch die grüne Variante hat ihre Tücken. Für sie muss zunächst erneuerbarer Strom erzeugt werden, dessen Umwandlung in Wasserstoff viel Energie kostet – das grüne Gas gilt deshalb als ineffizient. So würden fünf Windräder gebraucht, um tausend Haushalte mit Wasserstoff zu beheizen – nur eins wäre nötig, wenn Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Der kostbare Rohstoff, da sind sich Forschende einig, sollte nur dort eingesetzt werden, wo Strom nicht direkt genutzt werden kann.
Als ein Bereich, der nur mit grünem Wasserstoff klimaneutral werden kann, gilt die Stahlindustrie. Ihr Bedarf ist immens: Um ihn komplett zu decken, wären bei heutigem Stand sechzig Prozent der in Deutschland installierten Solar- und Windkraftleistung nötig. Diese Zahl führt zum nächsten Problem: Wo soll all der grüne Wasserstoff herkommen?
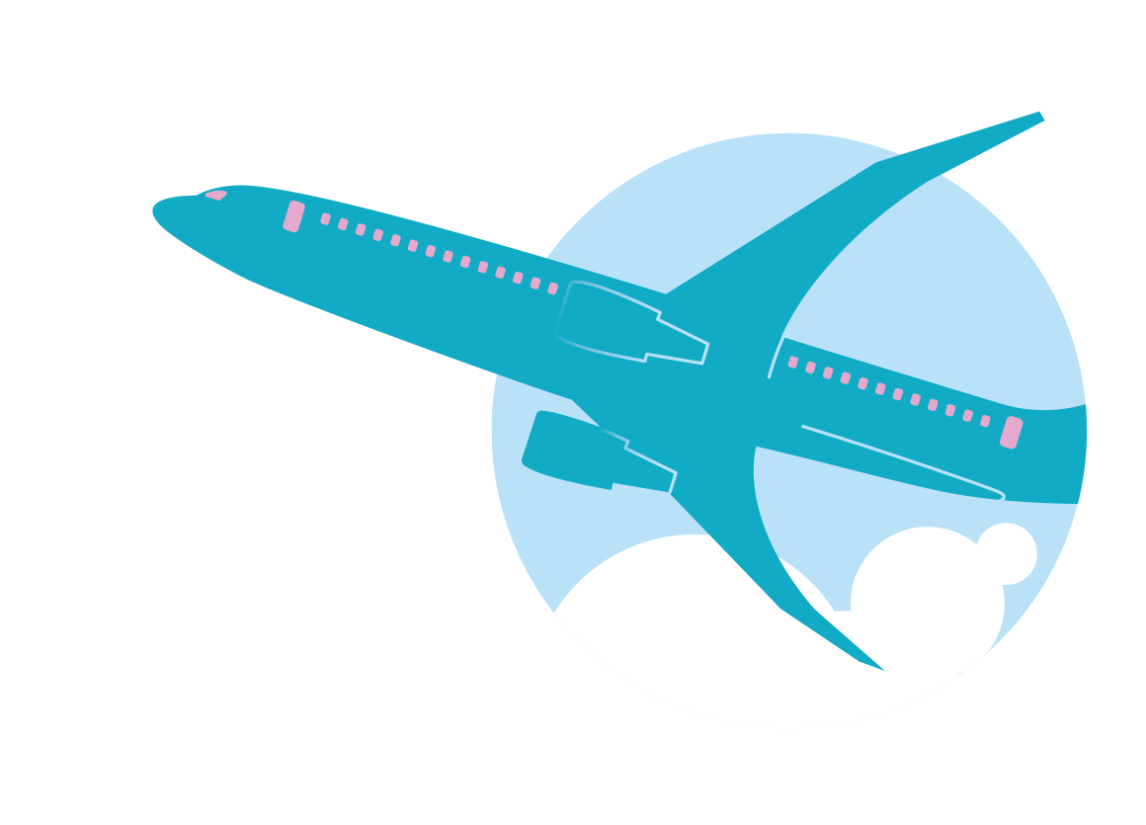
FLUGVERKEHR: Der Weg zum klimaneutralen Fliegen ist weit: Weil Wasserstoff viel Raum einnimmt, wird der direkte Einsatz auf der Langstrecke absehbar keine Rolle spielen – im Gegensatz zu E-Fuels auf Wasserstoffbasis. Doch deren Herstellung kostet viel Energie. Deshalb: Wenn immer möglich am Boden bleiben!
„Wenn wir nicht fünf oder zehn Prozent der Landesfläche mit Windkraftanlagen vollstellen wollen, brauchen wir Wasserstoffimporte“, sagte Robert Habeck 2022. Rund siebzig Prozent des von der Bundesregierung errechneten Bedarfs sollen aus dem Ausland kommen. Norwegen, Spanien und Portugal hat sie dafür im Blick sowie zahlreiche Länder außerhalb Europas – neben Kanada, Australien und Marokko auch Saudi-Arabien. Das deutsche Wasserstoffdiplomatiebüro „H2-Diplo“ ist dort bereits eröffnet.
Im September vergangenen Jahres reiste Kanzler Scholz an den Golf, begleitet von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Das Ziel: Der deutschen Industrie Zugang zum Zukunftsprojekt Neom zu verschaffen – und Wasserstoffimporte zu sichern.
Eine Woche nach Scholzʼ Besuch meldete die Menschenrechtsorganisation ALQST, ein Sonderstrafgericht habe drei Männer zum Tode verurteilt. Sie hatten sich gegen die Räumung ihres Dorfes gewehrt, das für Neom weichen sollte. Im Januar wurde das Todesurteil laut ALQST vollstreckt. Wie nachhaltig Wasserstoff ist, hängt also nicht nur davon ab, wie er produziert wird. Die Frage ist auch, zu welchem Preis für Mensch und Natur.
Lüderitz ist ein beschaulicher Ort mit sandigen Straßen und ein paar bunten Häusern aus der Kolonialzeit. 20.000 Menschen leben in dem Städtchen an Namibias Küste, das einst deutsche Auswanderer gegründet haben – und von dem aus deutsche Truppen einen Vernichtungskrieg gegen die Nama und Herero führten.
Bald soll der Ort 15.000 Menschen aufnehmen und sich so fast verdoppeln. Sie bauen das im Süden Afrikas wohl ambitionierteste grüne Wasserstoffprojekt in die Geröllwüste – in den Tsau-Khaeb-Nationalpark im Hinterland von Lüderitz. Afrika gilt als perfekter Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff. Sonne und Wind gibt es im Überfluss.
Hinter dem Projekt steht ein Konsortium namens Hyphen, bestehend aus dem deutschen Unternehmen Enertrag und der Investmentfirma Nicholas Holding. Zehn Milliarden Dollar soll der Bau kosten – das entspricht fast dem Bruttoinlandsprodukt Namibias – und jährlich 300.000 Tonnen Wasserstoff liefern. Geplant sind Solarparks und Hunderte Windräder auf 4000 Quadratkilometern, einer Fläche fünfmal größer als Hamburg. Um die Elektrolyseure mit Wasser zu versorgen, wird in Lüderitz eine Meerwasserentsalzungsanlage gebaut und eine Leitung in die Wüste gelegt. Eine zweite Pipeline soll den dort erzeugten Wasserstoff zur Küste transportieren, um ihn in einer neuen Fabrik in Ammoniak umzuwandeln, weil sich reiner Wasserstoff schwer verschiffen lässt. Für die Frachter wird ein Tiefwasserhafen gebuddelt.

SCHIFFFAHRT: Bei Fähren und Frachtern auf kürzeren Strecken haben E-Motoren die Nase vorn, doch auf internationalen Routen wird es ohne Wasserstoff nicht gehen. Um dreckiges Schweröl zu ersetzen, kann kurzfristig Methanol helfen, geforscht wird auch an Brennstoffzellen.
Ein Megaprojekt für ein Land mit 2,5 Millionen Menschen – und nur ein Bruchteil der Menge, die die EU bis 2030 importieren will: zehn Millionen Tonnen jährlich. Via Pipelines soll Wasserstoff aus Nordafrika kommen oder eben per Schiff in Form von Ammoniak oder anderen Derivaten. Größter Importeur wird Deutschland sein. Deswegen arbeitet die Bundesregierung derzeit an einer eigenen Importstrategie, gestützt durch den eigens erstellten „H2 Atlas Afrika“. Erste Ergebnisse liegen schon vor – und versprechen „enorme Potenziale“ in den „Produktions-Hotspots“.
Die Art, wie da am Bildschirm Gebiete nach ihrem Nutzen vermessen werden, erinnert manche an Zeiten, als die Kolonialmächte den Kontinent mit dem Lineal aufteilten, um seine Ressourcen auszubeuten. Dabei haben vierzig Prozent der Menschen in Afrika bisher selbst keinen Zugang zu Strom. Und nun soll der neue Ökostrom als Wasserstoff nach Europa fließen, um dort Wohlstand und Wachstum zu sichern?
Diesmal soll alles anders werden. So betonte Minister Habeck bei einem Besuch in Namibia: „Das Letzte, was wir akzeptieren dürfen, ist eine Art von grünem Energie-Imperialismus.“ Das Projekt, so Habeck, müsse zuallererst den Menschen vor Ort nützen. Geschichte muss sich nicht wiederholen. Doch klar ist: Die globalen Wasserstoffpläne werden Landschaften tiefgreifend verändern – und Konflikte mit den Menschen vor Ort verursachen. „Wir sprechen über Megaprojekte, die enorme Mengen an Wasser verbrauchen und riesige Flächen beanspruchen“, sagt Andreas Stamm vom German Institute of Development and Sustainability. Die Befürworter führen oft an, dass die Parks in dünn besiedelten Wüstenregionen entstehen sollen. Aber so einfach ist es nicht, das zeigt nicht nur das Neom-Projekt in Saudi-Arabien. In Südafrika ist einer der weltweit größten Wasserstoffparks auf Land geplant, das lokale Gemeinschaften gerade erst erfolgreich für sich zurückgefordert hätten, berichtet die Menschenrechtlerin Makoma Lekalaka. Und in Marokko, wo die größten Solarparks der Welt stehen, beklagen Aktivisten und Einwohnerinnen, dass das Grasland nomadischer Viehhirten besetzt worden sei. Hinzu kommt ein enormer Wasserverbrauch in einer Dürreregion, da die Paneele regelmäßig geputzt und gekühlt werden müssen. Nun sollen weitere riesige Parks für Energieexporte hinzukommen. Der hohe Wasserbedarf könnte zu einem der größten Probleme werden. Für jedes Kilo Wasserstoff sind bis zu zehn Liter Süßwasser nötig – und daran mangelt es meist, wo die Sonne zuverlässig scheint. Wird für die Elektrolyseure das lokale Grundwasser angezapft, kann das katastrophale Folgen für Menschen und Umwelt vor Ort haben. Als Lösung werden Meerwasserentsalzungsanlagen ins Feld geführt wie in Lüderitz. Doch deren Abfallprodukte – Salzlake und Chemikalien zur Reinigung der Rohre – können sensible Küstenökosysteme stören.
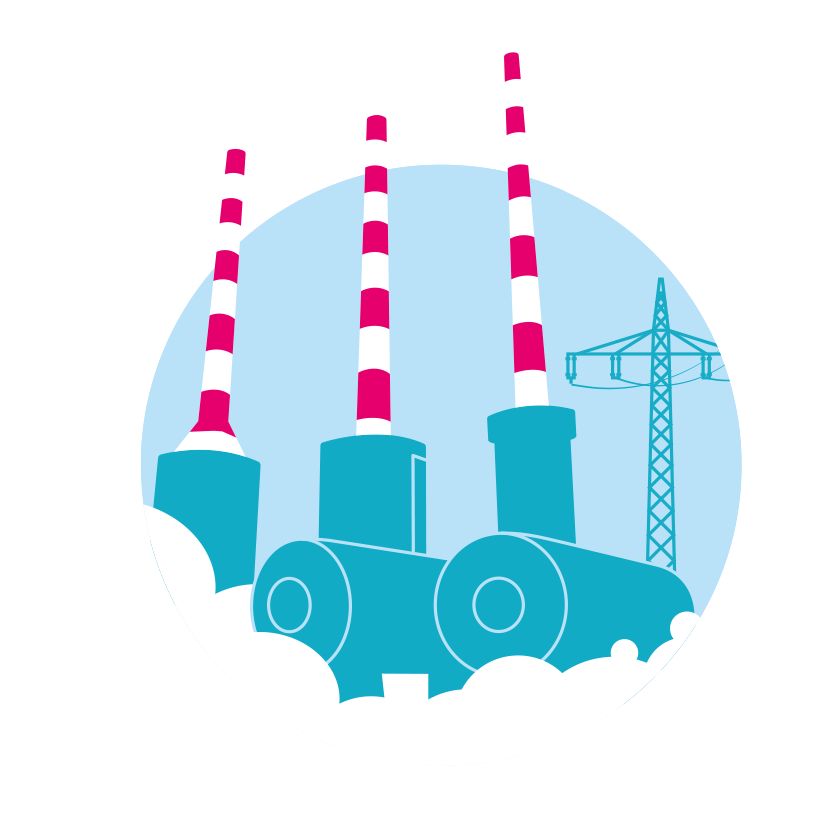
ENERGIESPEICHER: Größter Vorteil von Wasserstoff gegenüber Strom ist, dass er sich in großen Mengen speichern lässt, etwa in unterirdischen Kavernen. Künftig soll er in „Dunkelflauten“ – wenn Wind- und Sonnenkraft nichts liefern – in Gaskraftwerken verstromt werden. Wichtig ist aber auch, dass die Netze ausgebaut werden.
Also lässt der Norden doch wieder nur Dreck und Leid zurück? Darauf angesprochen schüttelt James Mnyupe energisch den Kopf. Er ist Wirtschaftsberater der namibischen Regierung und einer der Architekten von Hyphen. „Es waren wir, die die Welt zu uns eingeladen haben“, sagt er. Vor zwei Jahren habe Namibias Regierung das Projekt international ausgeschrieben. „Wir haben den Bietern einen klaren Kriterienkatalog vorgelegt: Wie viel Süßwasser entsalzt ihr und wie viel von dem Süßwasser gebt ihr an uns ab? Wie viel Strom produziert ihr auch für uns? Was tut ihr für die Umwelt?“ Den Zuschlag bekam schließlich Hyphen.
Tatsächlich könnte das Vorhaben ein Vorzeigeprojekt werden. Die Anlagen entstehen auf unbewohntem Gebiet. Ein Teil der erzeugten Energie soll dazu beitragen, die Haushalte von mehr als einer Million Menschen erstmals mit Strom zu versorgen, auch könnte Namibia damit unabhängig von südafrikanischem Kohlestrom werden. Die Entsalzungsanlage soll nebenbei ganz Lüderitz mit Trinkwasser versorgen. Neunzig Prozent der Jobs sollen an Namibier gehen – und Umweltstudien sollen klären, wo gebaut werden darf. Denn so lebensfeindlich die Gegend wirkt, sie ist ein Hotspot der Artenvielfalt, vor allem wegen seltener Pflanzen. Wenn im kommenden Jahr der Bau beginnt, wird sich zeigen, wie nachhaltig das Projekt wirklich ist. James Mnyupe hofft, dass Namibia mit einer auf Erneuerbaren basierenden Industrialisierung Vorbild für Afrika wird. Die dreckige Alternative befindet sich vor der Küste von Lüderitz unter dem Meeresgrund: Die Konzerne Shell und Total haben dort große Öl- und Gasfelder entdeckt, erste Bohrschiffe ankern schon. Gelingt es Namibia, mit Wasserstoff einen anderen Weg zu gehen und das Öl und Gas im Boden zu lassen, wäre das ein riesiger Gewinn für den Klimaschutz.

BUSSE, BAHNEN, LKW: In Städten und im Lieferverkehr sind Batteriefahrzeuge klar im Vorteil. Im Langstrecken-Schwerlastverkehr, bei Überlandbussen und auf Bahnstrecken ohne Oberleitung können Brennstoffzellen praktikabler sein – der Wettstreit der Systeme ist noch nicht entschieden.
3. Was ist das richtige Maß?
Eins ist jedoch noch weitgehend ungeklärt: wie der Wasserstoff nach Europa gelangen soll, ohne Schaden anzurichten. Ihn als Ammoniak zu verschiffen wie in Lüderitz geplant, um ihn in deutschen Häfen zurückzuverwandeln, ist ineffizient und teuer. Um den von der Bundesregierung prognostizierten Importbedarf von rund hundert Terawattstunden bis 2030 zu decken, müssten laut einer Fraunhofer-Studie rechnerisch zehn Ammoniaktanker in deutschen Häfen anlanden – pro Woche. Auch der Pipelinetransport birgt Gefahren: Durch Lecks austretender Wasserstoff verstärkt als indirektes Treibhausgas die Klimawirkung von Methan.
Am Ende ist die Menge entscheidend. „Wenn man die Wasserstoffwirtschaft wirklich nachhaltig denkt, muss man auch darüber reden, welche Produkte langfristig in Europa hergestellt werden sollten – und welche in Ländern, wo grüner Strom günstiger ist“, sagt Andreas Stamm. Laut einer aktuellen Studie der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende könnte die Menge an importiertem Wasserstoff deutlich geringer ausfallen, wenn industrielle Vorprodukte wie „grünes Eisen“ im Ausland produziert würden – statt Wasserstoff und Eisenerz nach Europa zu verfrachten. Und laut einem im Juni veröffentlichten Energieszenario von 26 europäischen Forschungseinrichtungen wären gar keine Importe nach Europa notwendig – wenn politisch andere Prioritäten gesetzt würden.
„Wasserstoff ist ein Baustein, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen“, sagt Frauke Wiese von der Universität Flensburg, die an der Studie beteiligt war. „Aber wirksamere Hebel als der überdimensionierte Umstieg auf Wasserstoff sind der effizientere Einsatz von Energie – und Suffizienz.“ Hinter dem sperrigen Begriff versteckt sich eine noch wenig beachtete Debatte: Was ist das richtige Maß beim Energieverbrauch – und wann ist genug genug? Es geht um die Idee eines ressourcenleichteren Lebens, um eine Wirtschaft, die die ökologischen Grenzen der Erde respektiert. Dafür wäre ein Umdenken in Politik und Gesellschaft notwendig. Vorerst muss man wohl mit Importen rechnen. Damit die möglichst grün sind, sollte die wertvolle Ressource auch als solche behandelt werden – als „Champagner der Energiewende“, wie es Claudia Kemfert gern formuliert.
Dieser Artikel erschien in der Ausgabe 5.23 "Dunkelmänner". Das Greenpeace Magazin erhalten Sie als Einzelheft in unserem Warenhaus oder im Bahnhofsbuchhandel, alles über unsere vielfältigen Abonnements inklusive Prämienangeboten erfahren Sie in unserem Abo-Shop. Sie können alle Inhalte auch in digitaler Form lesen, optimiert für Tablet und Smartphone. Viel Inspiration beim Schmökern, Schauen und Teilen!
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-09/gpm_6_24_titel_96dpi.jpg?h=52668bc7&itok=rdLw4n2T)
