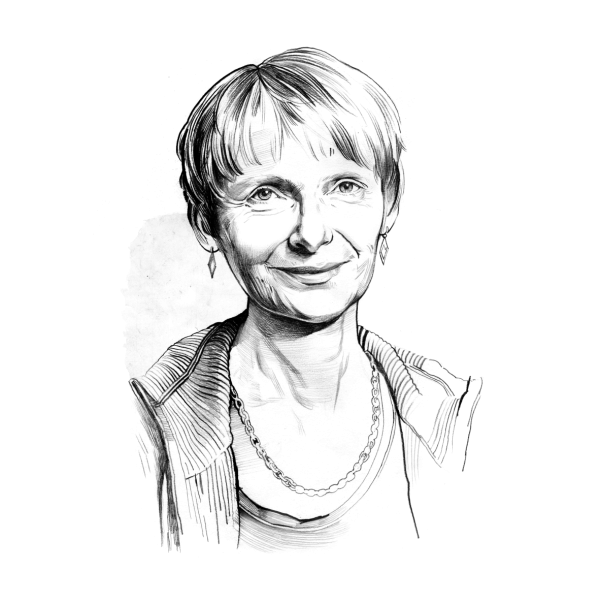Liebe Leserinnen und Leser,
das Statistische Bundesamt meldete unlängst, gut fünf Prozent der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren – immerhin 3,1 Millionen Menschen – seien nie online (Zahlen von 2023). Der IT-Branchenverband Bitkom hat per Umfrage ermittelt, dass 22 Prozent der Befragten kein Smartphone nutzen. Bei den über 65-Jährigen sei es mehr als ein Drittel, bei den 16- bis 29-Jährigen immerhin fünf Prozent.
Im Freundes- und Familienkreis gelte ich wahrscheinlich als eine Art weißer Rabe, denn auch ich besitze kein Smartphone. Ein Mobiltelefon habe ich zwar (yup, zum Aufklappen!), es kann sogar WhatsApp, bietet aber keinen Internetzugang. Das heißt, ich bin öfter mal offline und leide überhaupt nicht darunter. Als Besitzerin eines PC sowie eines Tablets fühle ich mich nicht wie ein Höhlenmensch und finde, dass ich ganz gut erreichbar bin. Nur eben nicht permanent online.
Zum Early Adopter bin ich auch wahrhaftig nicht berufen. Technische Errungenschaften waren bei uns zu Haus rar gesät, der erste Fernseher etwa hielt Einzug, als ich elf Jahre alt war. Was heißt hier Fernseher: Ein zweitüriger Schleiflack-Schrank, der als Hauptattraktion das ausladende Schwarzweiß-Gerät enthielt (nur erstes Programm), ferner oben einen Zehner-Plattenwechsler und unten ein Radio. Multimedia, gewissermaßen.
E-Mails nutze ich immerhin seit Mitte der Achtzigerjahre, denn Greenpeace, mein damaliger Arbeitgeber, verfügte dank eines Nerds namens Dick Dillmann von der Universität San Francisco schon zu dieser Zeit über ein System, mit dem man elektronische Nachrichten an und von Kolleginnen und Kollegen in aller Welt verschicken und empfangen konnte. Das System hieß Comet und stürzte auch manchmal kometenartig ab (vielleicht wurde es deshalb später in Greenlink umgetauft), aber im Großen und Ganzen funktionierte es. Und es war viel, viel schöner und weniger mühsam als Steno und Schreibmaschine, das habe ich nämlich auch mal gelernt.
Zum Internet stieß ich, ebenso zufällig, etwa Mitte der Neunzigerjahre, als es noch so richtig in den Kinderschuhen steckte. Meine Zeit als fest angestellte Greenpeace-Mitarbeiterin war zwar schon vorbei, aber ein paar Jahre lang arbeitete ich als freie Online-Redakteurin für Greenpeace. Es ergab sich, dass ich auch an diversen anderen Internetauftritten mit herumbastelte und häufiger Texte für die Websites von NGOs schrieb.
Als dann irgendwann das Smartphone auftauchte, hatte ich schon lange mit dem In-der-Welt-Herumgeistern aufgehört und sah staunend, wie um mich herum nach und nach fast alle dem kleinen rechteckigen Ding mit Haut und Haaren verfielen und mit direkter Ansprache nur noch schwer zu erreichen waren.
Oha, dachte ich, lieber erst mal abwarten. Das tue ich immer noch, denn erstens brauche ich es nicht wirklich und zweitens traue ich mir selbst nicht über den Weg. Den mündigen homo digitalis, der harsche Privatsphäre-Einstellungen vornimmt, sich bei der täglichen Nutzung streng diszipliniert und dem Nachwuchs, sofern vorhanden, ein leuchtendes Vorbild ist, mag es geben. Aber wer sagt mir, dass ich nicht auch so ein Zombie werde, der im Gehen, beim Rad-, E-Scooter- oder Autofahren und überhaupt immer den Blick stets fest auf sein Telefon heftet und auf Reisen eine Million Selfies schießt, statt sich die Gegend anzusehen?
Klar, es gibt viele Anwendungen, die das Leben vereinfachen, die Arbeit erleichtern und sogar der Umwelt nützen, das steht außer Frage. Sehr praktisch alles. Andererseits sind die Dinger gigantische Datenstaubsauger, Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser, und der Wunsch nach Privatsphäre ist den Tech-Monopolen ein Dorn im Auge. Wie es aussieht, haben die meisten den aber sowieso längt entsorgt – und haben ja auch nichts zu verbergen.
Eine Folgeerscheinung der Smartphonisierung ist der grassierende Digitalzwang. Das bedeutet: Zugang zu immer mehr Dienstleistungen, ob Behörden, Bahn, DHL, Banken, Kultureinrichtungen, ÖPNV, Mietwagen, Leihrädern, Lieferdiensten, Krankenkassen, Arztpraxen gibt es nur noch digital, mitunter eben nur noch mit Smartphone. Scannen Sie doch einfach den QR-Code! Da gehen dann schon mal ein paar Grundrechte flöten.
Das schreit nach Renitenz. Die Datenschützerinnen und Bürgerrechtler von Digitalcourage möchten deshalb das Recht auf ein analoges Leben ins Grundgesetz aufnehmen lassen. Auch in anderen Ländern, zum Beispiel Spanien, rebellieren Menschen gegen diese Art von digitaler Bevormundung. Wobei gegen die Digitalisierung als solche überhaupt nichts einzuwenden ist, nur: Es muss immer auch eine analoge Alternative geben, und zwar eine, die nicht extrem umständlich und/oder mit Extrakosten verbunden ist. Estland, das gelobte Land des Digitalen, macht vor, wie das geht.
Sollte Deutschland das eines schönen Tages auch hinkriegen und die Datenschnüffelei in den Griff kriegen, mal sehen, vielleicht schaffe ich mir dann ein Smartphone an.
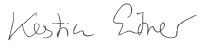
Kerstin Eitner
Redakteurin
Wochenauslese: Meldungen, Geschichten und Ansichten – (nicht nur) zum Thema Umwelt in Ihr E‑Mail-Postfach
![[object Object] [object Object]](https://gpm-cs.e-fork.net/sites/default/files/styles/abo_header_cover/public/2024-09/gpm_6_24_titel_96dpi.jpg?h=52668bc7&itok=rdLw4n2T)